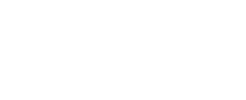Abb. 1: Einleitende Worte zur Verbreitungskarte von Bernd Bahn im Schlossmuseum Sondershausen (Foto: U. Tichatschke).
Erstmals wurden kostbare merowingerzeitliche Grabausstattungen vom Frauenberg und Sondershausen-Bebra sowie aus alamannischen, bajuwarischen und thüringischen Körpergräbern des späten 7. und 8. Jahrhunderts gezeigt, die veranschaulichen sollten, wie die Grabausstattungen der spätmerowingerzeitlichen Eliten einheitlich »zwischen Prunk und Politik« rangierten.
Gleich am Anfang der Sonderausstellung befand sich eine Karte, die den räumlichen Rahmen umriss (Abb. 1). Das Gräberfeld von Sondershausen-Bebra lag in der Niederung eines Taleinschnittes der Hainleite, wo über »das Geschling« seit vorgeschichtlicher Zeit eine wichtige Passage zwischen Harzrand und Thüringer Becken existiert, wie Wallanlagen und Gräber belegen.
Das Gräberfeld wurde ab 2005 im Vorfeld der Anlage Ortsumfahrung Sondershausen untersucht. Es umfasst Bestattungen von vier Männern, neun Frauen, acht Kindern und ein als »Zermonialbau« interpretiertes Gebäude. Besonders herausragend war das Grab einer 40–60-jährigen Frau ausgestattet. Goldene Ohrringe und eine Kette mit Glas- und Amethystperlen sowie Goldanhänger kennzeichnen sie als Teil der thüringischen »Elite«. Die Herkunft der Ohrringe ist im alamannisch-bajuwarischen Raum zu suchen.
Die adeligen Gräber beider Gräberfelder waren allesamt Holzkammergräber, während sie bei gleichzeitigen Grabanlagen der Region Steinkammergräber sind. Anhand von Beispielen wurden z.B. Ähnlichkeit der Zusammensetzung der männlichen Grabausstattungen der Gräberfelder mit denen im bajuwarischen und alamannischen Raum u.a. mit Sax, Sparta und Gürtelschmuckschnallen der männlichen Krieger oder auch im Hinblick auf vorkommende Mehrfachbestattungen bei Männern aufgezeigt.
Der zweite Teil der Exkursion führte bei bestem Wetter auf den Frauenberg bei Jechaburg. Jechaburg wurde als Ortschaft erstmals 1004 urkundlich im Kontext zur Chorherrenstift St. Peter und Paul des Erzbistums Mainz erwähnt, dessen Reste wahrscheinlich in der Substanz der heutigen stark überprägten Kirche stecken. Von dort begann der kurze aber steile Aufstieg zum 411 m hohen Frauenberg. Nach einem Einblick in die topographisch günstige Spornlage (Abb. 2) übernahm die Führung Sybille Jahn, die die dortigen Ausgrabungen zwischen 2007 und 2011 geleitet hat.

Abb. 3: Frau Jahn (Mitte) erläutert die unterschiedlichen Grundrisse auf dem Frauenberg (Foto: I. Vahlhaus).
In einem 2 m breiten Suchschnitt nach Westen wurde nach weiteren Besiedlungsspuren des Frauenberges gesucht. Dabei stellte sich heraus, dass sich unter einem vermeintlichen Wall eine Steinmauer befindet. Aufgrund des Fundmaterials lässt sich ein anderer Abschnittwall in die Urnenfelderzeit datieren. Außerdem gibt es Hinweise, dass der Frauenberg zeitgleich zu den Kirchenbauten und dem Gräberfeld besiedelt war.
Text: I. Vahlhaus