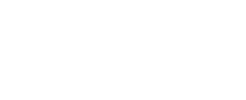Abb. 1: Gruppenbild vor dem Naturdenkmal »Dicke Eiche« in der Nähe der Wüstung Pferdingen (Foto: U. Münnich).
Im Quellbereich eines kleinen Baches oberhalb der Stollen liegt die Wüstung Eskaborn (im Gegensatz zum Bergbaurevier wird die Siedlung mit »a« geschrieben). Sie wird erstmals 1073 als Schenkung der Askanier an die Probstei Ballenstedt erwähnt und fiel im 14. Jahrhundert wüst. Andreas Karcher beschrieb am Waldrand die von ihm ausgemachten beiden Hofstellen und wies auf einen weiteren Bereich mit Dachziegeln hin, den er als Hinweis auf eine ehemalige Kirche deutet.
Die zweite Wüstung, Pferdingen, liegt nahe an dem Naturdenkamal »Dicke Eiche« (Abb. 1) und wird 1403 erstmals als Schenkung des Ulrich von Regenstein an die Kirche zu Quenstedt erwähnt. Bis heute gibt es Quenstedter Kirchenbesitz in der Nähe der 1608 aufgegebenen Siedlung. Die durch Aufsammlungen belegten Hofstellen liegen hier in unerwartet steiler Lage und vermutlich nahe des durch Melorationsmaßnahmen nicht mehr genau rekonstruierbaren Bachrandes.
Die nächste Station, der »Höllhaken«, ist ein nordwestlich ausgerichteter schmaler Bergsporn zwischen einem Seitental der Eine und einem weiteren Taleinschnitt. Zum wenig tiefer gelegenen Hinterland wurde dieser Sporn zu einem unbekannten Zeitpunkt und Zweck künstlich durch einen ca. 70 m langen, leicht gebogenen Wall mit bis zu 1,5 m (erhaltener) Höhe und einem vorgelagerten 4-5 m breiten und bis 1,5 m tiefen Graben abgeriegelt. Im weiteren Verlauf der Wanderung führte ein Hohlweg hinab ins Einetal. Einige hundert Meter talaufwärts steht dort der Rest eines Sühnekreuzes mit abgeschlagenem Kopf aus Karbonsandstein mit einer (möglicherweise nachträglich) angebrachten Jahreszahl von 1543 (Abb. 2).
Die letzte aufgesuchte Wüstung »Volkmannrode« wurde 1043 erstmals als Schenkung des Eskio von Ballenstedt an den späteren König Heinrich II erwähnt und Mitte des 15. Jahrhunderts verlassen. Die Besonderheit ist hier das zum ersten Mal 1489 erwähnte und zwei Mal im Jahr bis 1873 tagende Rügegericht mit bis heute erhaltener Gerichtshütte. Die Dachbalken der Gerichtshütte wurden nach jüngsten dendrochronologischen Untersuchungen 1707 gefällt.
Text: I. Vahlhaus